Gymnasium Langenhagen
 Fertig!
Fertig!
Mensa und Ateliergebäude der BAN
 Neue Räume für neue Pädagogik
Neue Räume für neue Pädagogik
Gymnasium Ziehenschule
 Gymnasium Ziehenschule
Gymnasium Ziehenschule
Kohlenbunkerensemble
 Kohlenbunkerensemble
Kohlenbunkerensemble
Das Lerndorf
 Das Lerndorf
Das Lerndorf
Kunst an der Burg
 Kunst an der Burg
Kunst an der Burg
Multi-Tenant-Gebäude Baufeld 63 Hafencity Hamburg
 Multi-Tenant
Multi-Tenant
Spielcasino am Ottoplatz
 Vor fünf Jahren: Spielcasino in Köln
Vor fünf Jahren: Spielcasino in Köln
Am Breiten Luch
 Lernwerkstatt
Lernwerkstatt
Servicegebäude Herzog August Bibliothek
 Servicegebäude
Servicegebäude
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber
 Musikhochschule
Musikhochschule
Mikrowohnen
 Mikrowohnen
Mikrowohnen
Mattes & Düxx
 Urbanes Ensemble
Urbanes Ensemble
Rathaus Reinheim
 Öffnung und bauliches Erbe
Öffnung und bauliches Erbe
Grüne Moschee Ruhr
 Religiöser Dialog
Religiöser Dialog
Haus des Wissens
 Nachhaltiges Wohnzimmer
Nachhaltiges Wohnzimmer
Schulbau Open Source
 SOS Weimar jetzt IBA Projekt 2023
SOS Weimar jetzt IBA Projekt 2023
Haus Altenberg
 Haus Altenberg in neuem Glanz
Haus Altenberg in neuem Glanz
Christkönigkapelle
 Neue Orgel für die Kapelle
Neue Orgel für die Kapelle
Bildungslandschaft Altstadt-Nord BAN
 Neue Räume für neue Pädagogik
Neue Räume für neue Pädagogik
Servicehaus des Kölner Studierendenwerkes
 Wettbewerb gewonnen
Wettbewerb gewonnen
Pixum
 Pixum in Köln ist fertig
Pixum in Köln ist fertig
Multifunktionskomplex Gesamtschule Oberhausen Osterfeld
 Wettbewerb gewonnen
Wettbewerb gewonnen
Mensa Campus Heide Süd
 Guten Appetit
Guten Appetit
Anerkennung beim Kölner Architekturpreis - 08. April

für unser Projekt Mensa und Ateliergebäude der Bildungslandschaft Altstadt Nord
Infos zum ProjektKI in Architektur und Kommunikation - 07. März
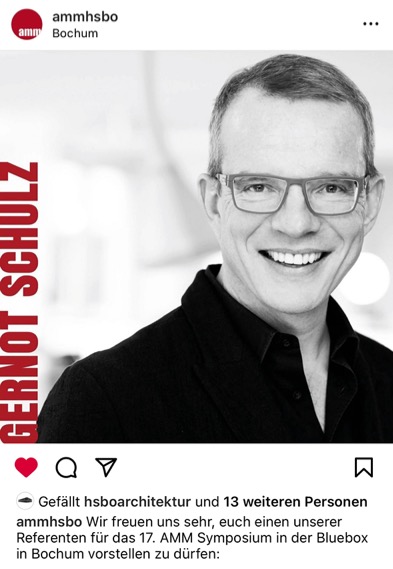
Zum 17. AMM-Symposium spricht Gernot Schulz über Transformation
Anmeldung und Infos gibt es hier:Covergirl - 05. Februar

Das Gymnasium Langenhagen auf dem Cover der Bauwelt 03/24
Hier geht´s zum ProjektMaterialpreis 2023 - 01. Dezember

Der Sonderpreis der KSV Natursteinwelt beim Materialpreis 2023 ging an das Mensa und Ateliergebäude der BAN.
Hier gehts zum ProjektPreis erhalten! - 23. November

Der BDA Landesarchitekturpreis Niedersachsen für unser Projekt
Gymnasium LangenhagenAnnerkennung - 21. November

Beim BDA Preis Vest erhielt das Marcel Callo Haus eine Anerkennung
Zum Projekt hier klickenVortrag von Gernot Schulz in Sevilla - 03. November

Kleiner Vortragstip für spontan Entschlossene
Mehr Infos zum Bild30 Jahre gernot schulz & architektur - 18. Oktober

Die letzte Veranstaltung in unserer Vortragsreihe!
Mehr Infos dazu finden Sie hier:30 Jahre gernot schulz & architektur - 06. September

Vortragsreihe mit aktuellen Themen zur Architektur.
12. September 19:00 haus der architektur hdak (ohne Anmeldung)
20. September KAP-Forum (nur nach vorheriger Anmeldung)
24. Oktober BDA Köln (ohne Anmeldung)
Hier gehts zur Veranstaltung am 12. SeptemberShortlist Heinze Award - 05. September

Unser Projekt Gymnasium Langenhagen ist nicht nur für den BDA Preis nominiert, sondern hat es auch auf die
Shortlist des Heinze Awards geschafft.BDA Preis Niedersachsen 2023 - 17. August

Gymnasium Langenhagen auf der Shortlist des BDA Preises Niedersachsen. Am 27.11. werden die Gewinner bekannt gegeben.
Hier gehts zur ShortlistSchulbaupreis 2023 - 31. Juli

Das Krönchen der Architekturpreise für unsere Bildungslandschaft.
Wir feiern mit!Competitionline Ranking - 27. April

11. Platz von 29.000 Architekturbüros für Hochbau in Deutschland.
Das feiern wir!Schlüssel übergeben - 28. Januar

Am Samstag wurde der Schlüssel für das Gymnasium Langenhagen an die Stadt und die Schule übergeben.
Hier geht´s zum ProjektEspacios y escenarios - 18. November

ein Vortrag von Gernot Schulz am 29.11.22 an der
Universität von Sevillain Betrieb gegangen - 01. November

ist das Mensa und Ateliergebäude der Bildungslandschaft! Bald mit neuen Fotos von
Stefan Schilling.AIT Innovationspreis Orgatec´22 - 25. Oktober

In diesem Jahr war Britta van Hüth als Vorsitzende der Jury
dabeiDesign Educates Award - 22. September

Abgeholt bei der Nacht im Foyer auf dem Solarluxcampus
für die BANFlachdach Contest - 11. Juli

Noch ein Preis für die Bildungslandschaft? Sehr gerne!
Stimmen Sie hier für uns abDiscover Germany - 08. Juli

Raumdenker – Wir revolutionieren die Bildungslandschaft.
Hier gehts zum ArtikelKomm wir bauen eine Schule - 21. Juni

Ein Beitrag des MDR zusammen mit Gernot Schulz und Raphaella Burhenne de Cayres
Hier geht´s zum BeitragSchloss Hückeswagen im neuen Gewand - 03. Juni

Zuschlag zur Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude und Innenräume des Schlosses erhalten.
Wir freuen uns über diesen neuen AuftragRoche Bobois in Haus Altenberg - 31. Mai

Heute fand im Goldenen Saal ein Fotoshooting für die französische Möbelfirma Roche Bobois statt. Haus Altenberg ist und bleibt ein tolles
ProjektGrundsteinlegung - 06. Mai

Presserummel bei der Grundsteinlegung von Mattes & Düxx unserem
Kölner HochhausprojektKunst an der Burg 2. Preis - 02. März

Beim Architekturwettbewerb für die Kunsthochschule Burg Giebichenstein haben wir den 2. Preis gewonnen. Hier gehts zum
ProjektHafencity Wettbewerb 3. Preis - 24. Januar

Beim Architekturwettbewerb für das Baufeld 63 im Quartier Strandkai konnten wir den 3. Preis verzeichnen. Hier gehts zur digitalen
WettbewerbsausstellungWir sind umgezogen! - 24. November

Ab dem 06.12.2021 erreichen Sie uns in unseren neuen Büroräumen auf dem
Sachsenring 69 in 50677 KölnPublikumsvoting erfolgreich! - 02. November

Vielen Dank für die vielen Klicks für unser Projekt Bildungslandschaft. Am 01.12.21 bekommen wir in Stuttgart einen der drei Preise verliehen… welcher? Das bleibt spannend!
Thumps up für die BAN:Publikumsvoting - 08. Oktober

Stimmen Sie hier für unser Projekt Bildungslandschaft ab!
Thumps up für die BAN:Shortlist - 07. Oktober

Hier winkt ein weiterer Preis: Die BAN ist für den Architekten Award´21 der Heinze GmbH nominiert.
Geben Sie uns hier Ihr Herz:Wie wir laufen lernten… - 29. September

Heute besuchten wir die Ausstellung der AIT Dialog „Wie wir laufen lernten…“ im Hof unseres Planungspartners Johannes Böttger von urbanegestalten. Mehr Bilder finden Sie
hier:Neue Mitte Tempelhof - 24. September

Interview mit Gernot Schulz zum Werkstattverfahren Neue Mitte Tempelhof. Interessantes Hintergrundwissen zum Verfahren.
Hier geht´s zum BeitragPreisverleihung - 15. September

Zusammen mit der Montag Stiftung und der Stadt Köln konnten wir uns den 3. Preis in der Kategorie Soziale Quartiersentwicklung abholen. Hier geht es zu den
PreisträgernEin Projekt der Superlative - 06. September

Errichtet in Holz-Beton-Hybridbauweise werden hier über 3.000qm Fassadenelemente, über 6.400qm Verbunddecken über4.500qm Stahlbetonfertigteile und über 1.000qm Fenster verarbeitet.
Weitere Infos finden Sie hier:Winner ICONIC AWARD 2021 - 31. August
wir freuen uns über die nächste und bestimmt nicht die letzte Auszeichnung unseres Projektes
Bildungslandschaft Altstadt Nordwie wir laufen lernten… - 30. August

wir sind dabei… eine Wanderausstellung mir Kinderzeichnungen von ArchitektInnen in sechs Städten in Deutschland.
Am 29.9. in KölnSchulbau ist auch Stadtplanung - 10. August

„Kaffeeklatsch mit Experten“ so heißt die Veranstaltungsreihe in der am 18.08.21 über innerstädtischen Schulbau und Quartiersentwicklung gesprochen wird. Hier gehts zur
Anmeldungmd 8/21 - 05. August

„Ein spektakulär geglücktes Vorhaben, dem man möglichst viele Nachahmer wünscht“ so die md in ihrer aktuellen Ausgabe über unser
Projekt BANAkteure der Baukultur - 04. August

Wir sind ab sofort Mitglied der Bundesstiftung Baukultur
Hier gehts zum Förderverein der BundestiftungArchitektouren - 02. August

FSB im Einsatz: Bei der BAN haben wir nach FSB gegriffen.
Hier geht es zur TourPolis Award 2021 - 05. Juli

Die BAN ist für den diesjährigen Polis Award in der Kategorie Soziale Quartiersentwicklung nominiert. Wir sind gespannt wie es weiter geht:
Preisverleihung am 15. September 2021Architekturpreis NRW 2021 - 01. Juli

Die BAN gewinnt den Architekturpreis NRW 2021!
Preisverleihung am 28. September 2021Team Gernot! - 25. Juni

Wir haben ein tolles Team und wie unser Fotograf zurecht feststellte absolut fotogen. Das Ergebnis des Fotoshootings ist bald hier auf unserer Seite zu besichtigen.
WirDer Katalog ist da - 16. Juni

Zum diesjährigen Kölner Architektur Preis ist der Katalog erschienen. Als einer der Preisträger findet man uns ganz vorne.
Erinnerungen - 13. Juni

Zum Tod von Gottfried Böhm erinnert sich Gernot Schulz in der Kulturwelt von Bayern2 an seine Kindheit im Bergischen Land und den Einfluss eines der größten Baumeister unserer Zeit. Klicken Sie auf 6.35
Brick Design - 11. Juni

Sanierung lohnt sich. Ein Gespräch mit Gernot Schulz im aktuellen Bauwelt Special.
Wandelbare Räume - 28. Mai

Am 01.06.21 lädt der AIT Architektur Salon zur Veranstaltung „Wandelbare Räume Lernorte“ ein. Als Referentin mit dabei: Raphaella Burhenne de Cayres die in den letzten 8 Jahren die Projektleiterin der Bildungslandschaft war und unsere Abteilung der Schulbauberatung leitet: Zur Anmeldung geht es
Zeit für Backstein - 21. Mai

Das Backstein Kontor würdigt unser Projekt BAN Bildungslandschaft Altstadt Nord gleich mit einer Doppelseite. Wir finden es sehr gelungen. Vielen Dank an Frau Scholten und Herrn Krutzke vom
Gelungene Montage - 09. April

Unser Schulprojekt in Langenhagen nimmt Fahrt auf. Diese Woche wurden die Holzträger für die Aula montiert:
Stellenanzeige erfolgreich! - 01. April

Wir dürfen zwei tolle neue Mitarbeiter begrüßen. Antonello Delia und Sebastian Natge sind nun Teil unseres
Gewonnen! - 26. März

„Hier möchte man gerne (wieder) zur Schule gehen……Chapeau!“ ließt man in der Jurybewertung des Kölner Architekturpreises. Wir bedanken uns für die Verleihung des Preises und die vielen schönen Worte die für unser Projekt gefunden wurden. Hier geht es zur
Abstimmung Bürohund 2021 - 25. März

Helfen Sie Daisy zum Bürohund 2021 zu wählen. Eine charmante Aktion von New Monday Jobs:
Stimmen Sie hier für Daisy ab!Einladung - 22. März

Es bleibt spannend. Verfolgen Sie mit uns die Preisverleihung des Kölner Architekturpreises. Hier geht es zum
LivestreamKölner Architekturpreis für die BAN??? - 18. März

Es wird spannend! Nachdem die Jury des Kölner Architekturpreises die Bildungslandschaft letzte Woche besucht hat, fiebern wir dem Ergebnis entgegen. Am 26.03. um 19 Uhr wird der Preis via Livestream vergeben. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite des
Kölner ArchitekturpreisesIm Westen was Neues! - 14. März

Wir feiern den zweiten Platz im aktuellen Baunetzranking NRW, nicht zuletzt Dank unseres
wunderbaren Teams:„der architekt“ - 04. März

„Ein schöner Gebrauch“ Andreas Denk berichtet in der aktuellen BDA Ausgabe „der architekt“ über unser Projekt „Bildungslandschaft“
Vielen Dank für den tollen Beitrag:Süße Überraschung - 16. Februar

Dieses Jahr bekommen wir neue Büroflächen. Auf unserem Insta Kanal sind die Instandsetzungsmaßnahmen zu verfolgen. Heute erreicht uns als Dankeschön eine süße Überraschung. Liebe Grüße an die Kollegen im Home Office, die Torte ist echt lecker! und Dank an Larbig und Mortag für die Aufmerksamkeit.
Exemplum - 01. Februar

Der Ziegelhersteller Röben hat ein sehr schönes Kundenmagazin heraus gegeben, darin unser Projekt „Rathaussanierung Reinheim“.
Bau des Jahres - 22. Januar

Auf der Internetseite von „german architects“ wird zur Abstimmung zum „Bau des Jahres“ aufgerufen. Mit dabei unser Projekt Bildungslandschaft-Altstadt-Nord in Köln.
DenkmalDienstag - 18. Januar

Das Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege der Fakultät für Architektur an der TH Köln lädt alle Studierenden, Lehrenden und Freunde der Fakultät herzlich zur Veranstaltungsreihe ‚DenkmalDienstag‘ ein. Am kommenden Dienstag startet die Veranstaltung mit unserem Geschäftsführer André Zweering und unserem Projekt Haus Altenberg.
Heute schon geflogen? - 06. Januar

Fliegen Sie mit uns über unter durch unser Projekt der Bildungslandschaft Altstadt Nord. Erleben Sie wie das Lernen von morgen heute schon aussieht.
Viel Spaß mit unserem neuen FilmGute Nachrichten bis zuletzt - 23. Dezember

Heute erfuhren wir, dass unser Projekt „Jugendbildungsstätte in Altenberg“ auf der Shortlist zum Fritz Höger Preis 2020 steht.
Wir freuen uns über die NominerungFrohe Weihnachten - 23. Dezember
Das Team von gernot schulz : architektur wünscht Ihnen Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Wir machen Betriebsferien und sind am 4. Januar 2021 wieder für Sie da.
Blick zurück - 17. Dezember

Das digitale Architekturmagazin Kölnarchitektur.de blickt auf ein spannendes architektonisches Jahr 2020 zurück. Mit dabei unser Schulprojekt die Bildungslandschaft Altstadt Nord.
Grundsteinlegung - 05. Oktober

Heute wurde feierlich der Grundstein zu unserem Schulprojekt dem Gymnasium Langenhagen gelegt. Hier werden in Zukunft 1.700 Schüler zur Schule gehen können. Mehr Bilder und den Link zu unserer Baustellencam
finden Sie hier:„Haus der Möglichkeiten“ - 21. August

Unser Projekt in Castrop wächst und die ersten Sichtbetonwände stehen.
Hier geht´s zu mehr Eindrücken von der BaustelleSCHULE NEU DENKEN - 12. August

Im aktuellen Newsletter des Kap Forums schreibt Uta Winterhager über unser Projekt die Bildungslandschaft BAN in Köln.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen:Stadtspaziergänge: Lernen braucht Perspektiven - 10. Juni

In der heutigen Zeit wichtiger denn je, Schule und Lehre neu zu überdenken. Die Journalistin Uta Winterhager schreibt in der aktuellen db erneut über unser Projekt die Bildungslandschaft Altstadt Nord. Ein Artikel den es zu lesen lohnt.
Zum Projekt geht es hier langNach Bochum pilgern - 25. Mai

So lautet der Titel des heutigen Baunetz-Newsletters. Vielen Dank für den tollen Beitrag!
Hier gehts zum BaunetzAlles mit Abstand - 20. Mai

Der Stadtbaurat und der Bürgermeister der Stadt Langenhagen beim ersten Spatenstich zum Gymnasium Langenhagen.
Hier geht´s zum ProjektNeues von der BAN - 12. Mai

Wir waren gemeinsam mit der Journalistin Uta Winterhager auf unser Baustelle der Bildungslandschaft Altstadt Nord. Herausgekommen ist ein wunderbarer Artikel über die BAN. Vielen Dank dafür, liebe Uta.
Lesen Sie hier weiterCompetitionline Ranking bekannt gegeben - 21. April

Das sagt competitionline: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
für brillante Ideen, Mut, literweise Herzblut, stahlharte Nerven, den Blick für das Wesentliche, Durchhaltevermögen und ein großartiges Team.
Sie können stolz auf sich sein!
Open Source Schulbau - 06. April

Vom Labor zum Iba Projekt. Das Baunetz berichtet heute über unser gemeinsames Schulprojekt mit der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft in Weimar.
Hier geht es zum ArtikelStellenanzeige erfolgreich! - 12. März

Wir sind glücklich in den letzten Wochen gleich vier neue Mitarbeiter für unser Team gefunden zu haben. Herzlich willkommen und guten Start! Du möchtest auch dazu gehören?
Kulturbauensemble Oberhausen - 12. März

Wir sind mit der Kamera durch den Entwurf geflogen.
Lassen Sie sich inspirierenKampfmittelräumung abgeschlossen - 10. März

Was aussieht wie das nächste Filmset zur Mondlandung ist das Ergebnis der Kampfmittelräumung in unserem Schulprojekt in Langenhagen. Wir freuen uns nun über den erfolgten Baubeginn mit der Erstellung der Baugrube.
Schauen Sie doch mal vorbeiWettbewerbsergebnisse werden ausgestellt - 17. Januar

Vom 20.-26. Januar werden die Ergebnisse des Realisierungswettbewerbs „Büro Campus Deutz 4+5 Bauabschnitt“ im Foyer der Hauptzentrale der STRABAG an der Siegburger Straße 241 in Köln Deutz ausgestellt.
Haus Altenberg — Der Film - 01. Januar

Wir wünschen Ihnen ein fantastisches 2020. Starten Sie das neue Jahr mit unserem Film über das
Haus AltenbergWettbewerb Haus des Wissens entschieden - 10. Dezember

Alle Wettbewerbsarbeiten werden vom 10.-20.12. im Foyer des Technischen Rathauses öffentlich ausgestellt. Die Eröffnungsveranstaltung findet dort am 10.12. um 17:00 Uhr statt.
Mehr zum WettbewerbWeihnachtsmarkt in Altenberg - 06. Dezember

Am Wochenende fand am Altenberger Dom ein sehr schöner Weihnachtsmarkt statt.
Eine gute Gelegenheit sich unser Projekt mal näher anzuschauenEvolution der Schulbaufassade - 05. Dezember

Raphaella Burhenne de Cayres begeisterte auf der Architects@Work rund 200 Zuschauer mit ihrem Vortrag.
Pünktlich zum Vortrag erhielt unser Schulprojekt in Weimar den offiziellen IBA Status 2023Top Speaker - 25. November
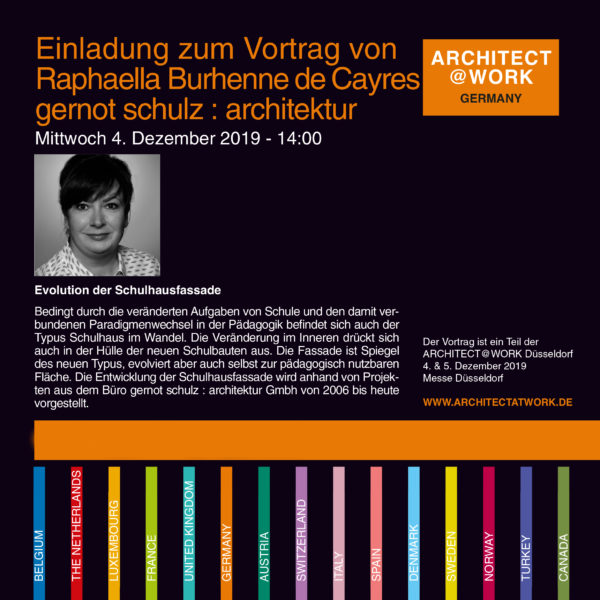
Raphaella Burhenne de Cayres spricht auf der Architects@Work über die Evolution der Schulhausfassade. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Hier geht's zu den TicketsErster Spatenstich im Projekt Widumer Tor - 15. November

Das Team aus Planern, Architekten, ehrenamtlichen Kräften der Gemeinde St. Lambertus und Mitarbeitern der Stadt Castrop- Rauxel freuen sich auf das Projekt am Widumer Tor.
Die Ruhrnachrichten berichteten ausführlichBack to School – Auf zur Neuen Bult - 30. Oktober

In einem emotionalen Abschied von der alten Schule, wanderten die Schüler des Langenhagener Gymnasiums zu ihrem neuen Grundstück auf der Neuen Bult und feierten dies mit einem rauschenden Fest. Wir freuen uns mit ihnen!
Der Film zum FestZukunftsfähige Schulgebäude - 14. Oktober

„Was bedeutet pädagogische Architektur?“ Dieser Frage stellen sich die Stadt Köln zusammen mit dem BDA Köln in einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am 30.10.2019 ab 18 Uhr. Vorab gibt es die Möglichkeit sich über unseren Neubau der BAN – Bildungslandschaft Altstadt- Nord bei einer Führung zu informieren. Den Link dazu finden Sie hier:
BDA KölnDie neue Website ist live - 08. Oktober

Informativer, moderner und responsiv. Dürfen wir vorstellen, unsere neue Website! Wir möchten begeistern mit dem was wir tun, für wen wir es tun und sagen Ihnen wer wir sind. Wir freuen uns auf Sie!
Büro Bloock freut sich mit uns„Tödliches Komplott“ - 14. September

Im aktuellen ZDF Krimi wird aus unserem Projekt in Fellbach ein Tatort. Wir gratulieren der Phillip Hafner GmbH und Ko. KG zum gelungenen Coup. Hier geht es zum Filmbeitrag:
ZDFSommerfest im Garten - 19. Juli
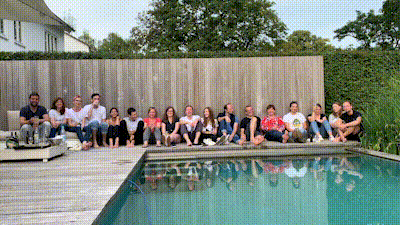
Bei fantastischem Wetter klang ein anstrengender Besichtigungstag im Garten aus. Wir besuchten unsere Projekte, die Jugendbildungsstätte in Altenberg und die Baustelle der Bildungslandschaft in Köln.
Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -

Instagram -








